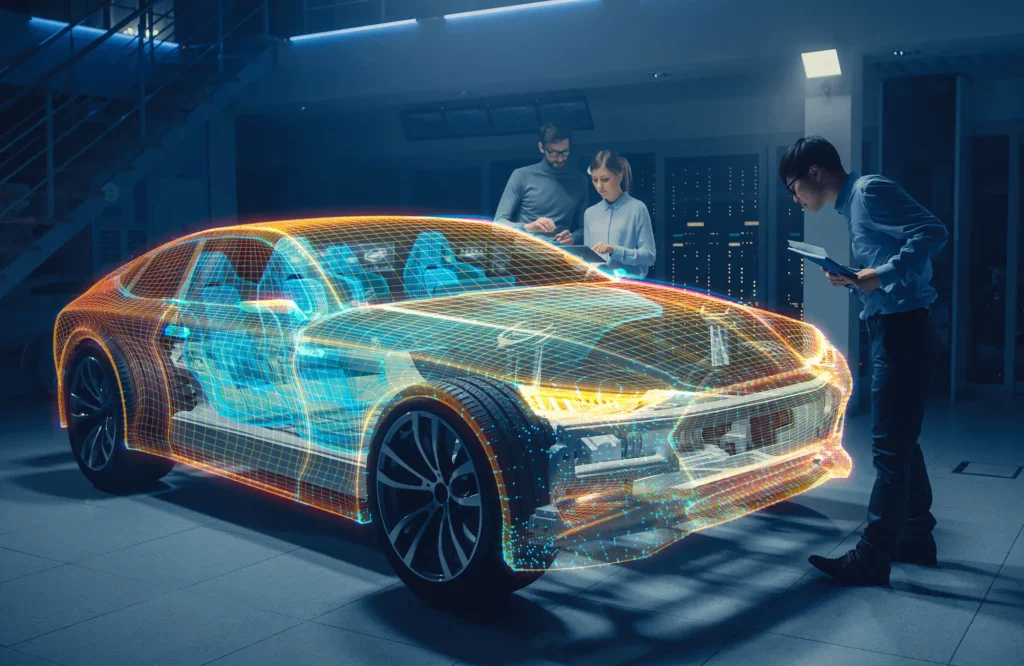Datenschutz in der Apotheke
Externer Datenschutzbeauftragter für Apotheken
Datenschutz in der Apotheke
Externer Datenschutzbeauftragter für Apotheken
Apotheken sind in besonderer Hinsicht von der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) betroffen, denn
- Apotheken verarbeiten sensible Gesundheitsdaten
- Apotheken verarbeiten Daten u.a. auf Grundlage von Einwilligungen
- Apotheken übermitteln (sensible) Daten an Dritte
Sichern Sie Ihre Apotheke jetzt gegen empfindliche Strafen ab, denn es drohen hohe Bußgelder: je nach Verstoß bis zu 2% Jahresumsatz / 10 Mio. EUR oder 4% Jahresumsatz / 20 Mio. EUR