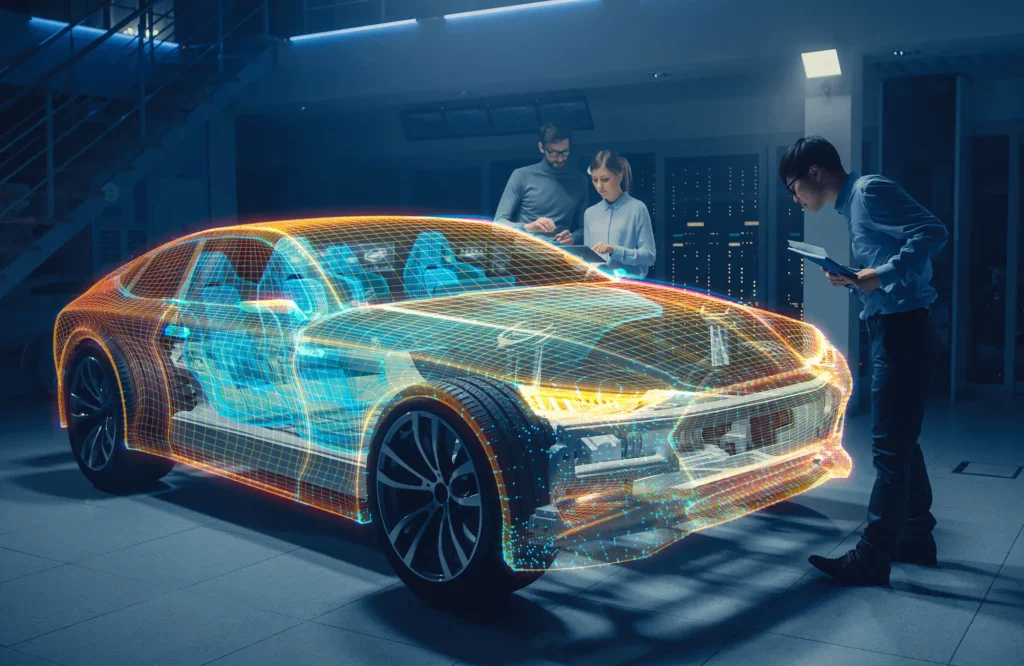Arbeitszeitgesetz (ArbZG)
Das Arbeitszeitgesetz regelt die tägliche Höchstarbeitszeit, Pausen- und Ruhezeiten sowie Bedingungen von Nacht- und Schichtarbeit.
Arbeitszeitgesetz (ArbZG)
Das Arbeitszeitgesetz regelt die tägliche Höchstarbeitszeit, Pausen- und Ruhezeiten sowie Bedingungen von Nacht- und Schichtarbeit.
Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) bildet die Grundlage für die Regulierung der Arbeitszeit in Deutschland. Es soll die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer gewährleisten und Rahmenbedingungen für flexible Arbeitszeiten schaffen.
Arbeitszeit im Sinne des Gesetzes ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende des Arbeitstages, ohne die Ruhepausen. Dabei darf die werktägliche Arbeitszeit grundsätzlich acht Stunden nicht überschreiten. Sie kann jedoch vorübergehend auf bis zu zehn Stunden verlängert werden.
Das Gesetz differenziert außerdem zwischen Ruhepausen und Ruhezeiten:
Arbeitnehmer haben das Recht bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden auf eine Ruhepause von mindestens 30 Minuten. Eine Pause stellt dabei eine Unterbrechung der Arbeitszeit dar, in der ein Arbeitnehmer keine Arbeitsleistung zu erbringen hat und die Zeit seiner Erholung dient. Da die gesetzlichen Pausenzeiten unbezahlte Zeit darstellen, dürfen Arbeitgeber diese von der Arbeitszeit abziehen.
Zwischen zwei Arbeitstagen muss eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 11 Stunden nach Beendigung der täglichen Arbeit eingehalten werden.
Das Arbeitszeitgesetz gilt sowohl im Büro als auch im Home-Office. Arbeitgeber sind seit September 2022 dazu verpflichtet die tatsächlich geleistete Arbeitszeit im Betrieb zu erfassen und zu dokumentieren. Dabei muss das System objektiv, verlässlich und zugänglich sein. Die Dokumentation unterliegt grundsätzlich einer Aufbewahrungspflicht von zwei Jahren.
Seit 2023 liegt auch ein Gesetzesvorschlag zur Arbeitszeiterfassung vor, der die Pflicht der elektronischen Zeiterfassung vorsieht.
Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz, wie beispielsweise das Nichtaufzeichnen von Überstunden, stellen Ordnungswidrigkeiten dar, die mit Geldbußen bis zu 30.000 Euro geahndet werden können.
Kontakt
Governance, Compliance & Risk Advisory
E-Mail: compliance (at) dreyfield.de
Telefon: +49 (0) 89 12414-9020